|

|
|
|

|
|
|
|
Offizielles Organ der Vereinigung
Europäischer Schifffahrtsjournalisten
|
|
|
|
|
|
Dipl.-Ing. Peter Pospiech
1. Vorsitzender der VEUS und
Ressortleiter VEUS-LOG im SeereisenMagazin
Telefon +49-49 52-82 69 087
Mobil +49-1 71-62 90 729
pospiechp@googlemail.com
|
|
|

|
|
 |
|
|
|
 Bald nur noch ein historischer Anblick? Die betagte,
aber beliebte Bornholm-Fähre POVL ANKER einlaufend Sassnitz-Mukran.
Foto: Kai Ortel, Berlin Bald nur noch ein historischer Anblick? Die betagte,
aber beliebte Bornholm-Fähre POVL ANKER einlaufend Sassnitz-Mukran.
Foto: Kai Ortel, Berlin
|
|
|
Keine Fähre nach Bornholm?
|
|
|
|
Die Wogen schlagen hoch auf Bornholm. Mitte
Dezember letzten Jahres hatte das dänische Verkehrsministerium den
„Trafikforliget 2014” verabschiedet, den Rahmenplan für die Zukunft des
Fährverkehrs zur Ostseeinsel. Vor allem auf Bornholm selber sieht man darin
aber kaum eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Plan, und zudem droht
damit auch noch der beliebten Sommerfährlinie von Sassnitz (Mukran) nach
Rønne ab 2017 die Schließung. Doch der Reihe nach.
Der Fährverkehr nach Bornholm hat in den
vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Veränderungen erlebt. Nachdem
zunächst im September 2004 die traditionelle Nachtfährlinie von Kopenhagen
nach Rønne eingestellt worden und durch die Linie Køge – Rønne ersetzt
worden war, wurden 2005 mit der DUEODDE und HAMMERODDE zwei neue Fährschiffe
in Dienst gestellt, die weniger auf den Passagier- und mehr auf den
Frachttransport zur Insel ausgerichtet waren. Die 1979 gebaute JENS KOFOED
wurde verkauft und ihr ein Jahr älteres Schwesterschiff POVL ANKER zur
Reservefähre umfunktioniert. Seit der Indienststellung der Schnellfähre
VILLUM CLAUSEN auf der Schweden-Route Rønne – Ystad (2000) kommt die POVL
ANKER daher hauptsächlich im Saisonverkehr zwischen Rønne und Sassnitz
(Mukran) zum Einsatz. Im Oktober 2010 firmierte der Dienst von
Bornholmstrafikken in BornholmerFærgen um und nahm ein Jahr später mit der
LEONORA CHRISTINA eine weitere Schnellfähre in Dienst; die DUEODDE wurde
nach nur fünf Jahren bereits wieder verkauft.
Da viele innerdänische Fährlinien jedoch nicht
ganzjährig profitabel betrieben werden können, gewährt der dänische Staat
finanzielle Zuschüsse, die an bestimmte vorab verhandelte Bedingungen
geknüpft sind. Im Rahmen der gegenwärtigen Konzession, die noch bis Ende
2016 läuft, verpflichtet sich so die Reederei BornholmerFærgen, eine
Reservefähre vorzuhalten, die bei Bedarf (z.B. wenn bei zu großen
Wellenhöhen die Katamaranfähren im Hafen bleiben müssen oder wenn diese
wegen technischer Defekte kurzfristig ausfallen) den Fährverkehr nach Ystad
und/oder Køge unterstützt oder komplett übernimmt. In der Sommersaison
bedient diese Reservefähre, besagte POVL ANKER also, traditionell die
Fährlinie zwischen Deutschland und Bornholm, da diese für die vielen
deutschen Bornholm-Urlauber die einzige Möglichkeit darstellt, die Insel
direkt zu erreichen.
Der neue Verkehrsvertrag, der Anfang Dezember
vorgestellt wurde und ab 2017 gelten soll, hat jedoch für die Linie Sassnitz
– Rønne einschneidende Konsequenzen, und das obwohl diese Route genau
genommen gar nicht Bestandteil des Verkehrsvertrages ist. Zum einen sollen
direkte Subventionen in Höhe von 17 Millionen DKK für eine Reduzierung der
Ticketpreise bei BornholmerFærgen (in der Nebensaison) um 10 Prozent
verwendet werden. Geknüpft sind diese aber an Einsparungen, die sowohl die
Zugverbindung von Ystad nach Kopenhagen als auch die Tonnage der Reederei
betreffen. So werden nämlich alle durchgehenden IC-Verbindungen zwischen dem
südschwedischen Hafen und der dänischen Hauptstadt abgeschafft; die
Alternative ist ab 2017 der schwedische Regionalzug bis Malmö, wo dann ein
Umsteigen in den Öresundzug nach Kopenhagen erforderlich wird. Diese
Maßnahme allein führt zu Einsparungen in Höhe von 31 Millionen DKK. Die
zweite und aus deutscher Sicht bedeutendere ist jedoch, dass Zuschüsse ab
2017 nur noch für eine Reservefähre mit einer Kapazität für „mindestens 400
Passagiere” gewährt werden. Was faktisch zur Außerdienststellung der
betagten, aber populären POVL ANKER nach dem Sommer 2016 und somit zu
Einsparungen in Höhe von weiteren 30 Millionen DKK führt. Das Reserveschiff
von BornholmerFærgen ist dann nämlich die HAMMERODDDE. Und damit fangen die
Probleme an.
Denn während auf Bornholm allein wegen der so
empfundenen Verschlechterung der Verkehrsanbindung an Kopenhagen via Ystad
bereits fleißig Unterschriften gesammelt werden, sorgen sich deutsche wie
dänische Ferienhausvermieter um ihr Geschäft auf der Insel, wenn nun auch
noch die Zukunft der Fähre von Rügen nach Rønne in Frage steht. Eines ist
nämlich sicher: Die Hauptlast des Saisonfährverkehrs von Deutschland nach
Bornholm hat in den letzten Jahren nicht umsonst nicht etwa die kleine
HAMMERODDE (400 Passagiere, 200 PKW, 1.500 Meter Frachtstellfläche), sondern
die wesentlich größere POVL ANKER (1.500 Passagiere, 256 PKW, 540 Meter
Frachtstellfläche) getragen. Wenn BornholmerFærgen jedoch ab 2017 mit der
HAMMERODDE nur noch über eine einzige konventionelle Fähre verfügt, die
darüber hinaus nicht nur mit ihrer täglichen Rundreise nach Køge fest in den
Fahrplan eingebunden ist, sondern im Notfall auch noch auf der Linie nach
Ystad aushelfen muss, ist für eine Verbindung nach Sassnitz weder genügend
Zeit noch genügend Kapazität vorhanden. Davon, dass ein konventionelles
Fährschiff mit 400 Passagieren Fassungsvermögen eine mitten im Hochsommer
(bis zu 8.200 Passagiere täglich!) ausfallende Schnellfähre auch nicht
annähernd ersetzen kann, einmal ganz abgesehen. Wie könnte also die Zukunft
des Fährverkehrs zwischen Deutschland und Bornholm aussehen? Fünf Szenarien:
1. Die kleine HAMMERODDE übernimmt die
Fährlinie
Die HAMMERODDE dürfte auch weiterhin die Nachtfährlinie
zwischen Køge und Rønne bedienen, wäre also tagsüber durchaus für eine
Rundreise nach Sassnitz frei. Dies würde allerdings einen drastischen
Einschnitt an Kapazität auf der Deutschland-Route bedeuten. Die Preise
dürften steigen, und eine Überfährt für den Sommer muss man dann noch früher
buchen als aktuell ohnehin schon. Wer keinen Platz mehr bekommt oder sogar
spontan nach Bornholm will, dem bleibt nur der Weg über Køge oder (via
Sassnitz – Trelleborg) über Ystad. Was nicht nur eine deutlich längere und
teurere, sondern auch wesentlich umständlichere Anreise wäre. Außerdem ist
der Fahrplan der Route Køge – Rønne eng (Ankunft in Rønne aus Køge: 06:00
Uhr, Abfahrt von Rønne nach Køge: 17:00 Uhr), die HAMMERODDE darf sich also
weder auf der einen noch auf der anderen Linie Verspätungen leisten, wenn
sie tagsüber dann zusätzlich noch nach Sassnitz und zurück muss. Und in
Ystad darf keine Schnellfähre ausfallen, denn dann müsste die Reservefähre
ohnehin auf der subventionierten Verbindung nach Schweden aushelfen. Eine
Rechnung mit vielen Unbekannten und alles andere als eine Ideallösung.
2. Schnellfähre VILLUM CLAUSEN
übernimmt die Fährlinie
Die zweite Schnellfähre von BornholmerFærgen liegt
außerhalb der Hochsaison schon jetzt überwiegend auf, und ihr Einsatz auf
der Sassnitz – Rønne-Route würde nicht nur alle Kapazitätsprobleme mit einem
Schlag lösen, sondern auch die Überfahrtszeit von Deutschland aus
signifikant verkürzen. Allerdings ist der Treibstoffverbrauch der bis zu 41
Knoten schnellen VILLUM CLAUSEN enorm hoch und der Saison-Fährverkehr auf
der Sassnitz – Rønne-Linie schon jetzt bestenfalls kostendeckend. Um den
Einsatz der VILLUM CLAUSEN nach Rügen zu rechtfertigen, müssten die
Treibstoffpreise also schon ziemlich weit in den Keller gehen. Außerdem sind
die Tage, an denen das Schiff in der Hochsaison als Unterstützung nach Ystad
gebraucht wird (Fr – So), dieselben, an denen man es auch nach Sassnitz
einsetzen müsste. Höchst unrealistisch.
|
|
3. Die POVL ANKER bleibt
BornholmerFærgen könnte den bisher quersubventionierten
Fähr-Oldtimer POVL ANKER behalten und auch noch nach 2017 zwischen Sassnitz
und Rønne einsetzen – dann allerdings auf eigene Kosten und auf eigenes
Risiko. (Letzteres könnte man höchstens mit der Option abfedern, das Schiff
außerhalb der Saison als Wohnschiff oder anderweitig gewinnbringend zu
verchartern.) Auf diese Möglichkeit angesprochen, hat der Færgen-Direktor
aber schon frühzeitig abgewinkt. Die Sassnitz-Linie ist bisher schon kaum
kostendeckend gewesen, und daran wird sich
erst recht nichts ändern, wenn
die Zuschüsse für die POVL ANKER als Reservefähre wegfallen. Seit dem 1.
Januar 2015 fährt das Schiff darüber hinaus übrigens aufgrund der neuen
Schwefelemissionsobergrenzen im SECA-Raum mit teurem Marine Diesel Oil
(MDO). Mit dann 38 Dienstjahren hat die POVL ANKER 2016 vermutlich das Ende
ihres Schiffslebens erreicht; jede künstliche Verlängerung (wie auch immer
finanziert) wäre höchstens eine Übergangslösung.

Anzeige


4. Neue Reederei, neues Schiff
Da die Linie Sassnitz – Rønne nicht Bestandteil des
Verkehrsvertrages der dänischen Regierung ist, kann theoretisch jede
Reederei diese Linie bedienen, die sich vorstellen kann, sie profitabel zu
betreiben. Dass man mit einem solchen Vorhaben nicht nur bei den Bornholmern
selbst, sondern auch auf deutscher Seite offene Türen einrennen würde,
versteht sich von selbst. Doch die Realität sieht auch hier anders aus, denn
wenn die Linie eine Goldgrube wäre, würde es schon jetzt einen Mitbewerber
für BornholmerFærgen geben. Der einzige ernst zu nehmende Konkurrent, die
staatliche polnische Fährreederei Polferries, hat jedoch auch seine
Direktverbindung von Swinoujscie nach Rønne 2010 eingestellt. Ein Newcomer
müsste also nicht nur ein Schiff mitbringen, das gleichzeitig groß, modern
und wirtschaftlich ist, sondern das auch noch sämtliche aktuellen
Umweltauflagen erfüllt. Ein Wunschtraum, leider.
5. Ein Ende mit Schrecken
BornholmerFærgen stellt die Linie Sassnitz – Rønne nach
der Sommersaison 2016 komplett ein, weil sie mit reduzierter Kapazität nicht
mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, und ein Nachfolger findet sich
auch nicht. Die Route wäre damit Geschichte und der einzige Weg, Bornholm
von Deutschland aus zu erreichen, würde fortan über Rostock, Gedser und Køge
oder gleich über Südschweden führen. Die Konsequenz: ein Alptraum für das
Tourismusgeschäft auf der Insel. Denn aktuell liegt der jährliche Umsatz mit
deutschen Touristen auf Bornholm bei cirka 500 Millionen DKK. Rund 525.000
Übernachtungen deutscher Touristen auf Bornholm zählte man zuletzt pro Jahr,
davon 325.000 in den bei deutschen Reisegästen so beliebten Ferienhäusern.
Sollte die direkte Fährlinie nach Rønne eingestellt werden, so schätzt man,
würden mit einem Schlag auch 300.000 bis 400.000 Übernachtungen deutscher
Touristen wegfallen, die dann nämlich der Insel den Rücken kehren. (Einer
aktuellen Internet-Umfrage zufolge würden 68 Prozent der befragten deutschen
Bornholm-Touristen nicht nach Bornholm fahren, wenn es keine direkte
Fährverbindung mehr gibt.) Ein Horrorszenario, schließlich stellen Deutsche
in der Herkunftsstatistik den größten Anteil an ausländischen Touristen auf
der Insel.
Hinzu kommt, dass der deutsche Reisemarkt in Sachen
Bornholm schon jetzt tief verunsichert ist, nachdem infolge der Diskussion
um den neuen Verkehrsvertrag Anfang des Jahres diverse Falschmeldungen und
Halbwahrheiten diesbezüglich im Internet kursierten. Tatsache ist: 2015 gibt
es noch eine Fähre nach Bornholm, sogar mit einer erhöhten Abfahrtsfrequenz
in der Hauptreisezeit und einer ausgedehnten Saison, die dieses Jahr von
Ende März bis Ende Oktober geht. Und auch 2016 fährt die POVL ANKER von
Sassnitz nach Rønne. Bis sie außer Dienst gestellt wird und eine neue Lösung
gefunden ist, sind also noch knapp zwei Jahre Zeit. Kai Ortel
www.faergen.dk
Beförderungszahlen Sassnitz (Mukran)–Rønne
2004 bis 2013
| Jahr |
Passagiere |
PKW |
| 2004 |
121.642 |
32.003 |
| 2005 |
90.816 |
25.395 |
| 2006 |
95.795 |
26.633 |
| 2007 |
101.787 |
28.263 |
| 2008 |
101.105 |
27.991 |
| 2009 |
93.046 |
26.038 |
| 2010 |
93.241 |
26.290 |
| 2011 |
102.746 |
28.568 |
| 2012 |
98.410 |
28.158 |
| 2013 |
94.623 |
26.977 |
|
|
|

Schon optisch mehr als Fracht- denn als
Passagierfähre zu erkennen: Die HAMMERODDE im neuen Anstrich von
BornholmerFærgen.
Foto: Ehrenberg Kommunikation, Hamburg
|
|

Wegen ihres hohen Treibstoff-Verbrauchs nur in der
Theorie ein Ersatz für die populäre POVL ANKER: Schnellfähre VILLUM CLAUSEN.
Foto: Kai Ortel, Berlin
|
|
|
|
 Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die
Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm
der Entrüstung gesorgt.
Foto: Kai Ortel, Berlin Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die
Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm
der Entrüstung gesorgt.
Foto: Kai Ortel, Berlin |
|
|
 |
|
|
|

Ohne Zweifel gilt der Containertransport unter Experten als die
wichtigste Transport-Revolution des 20. Jahrhunderts.
|
|
|
|
20/8/8 Fuß – die Maßeinheit der Globalisierung
|
|
|
|
Während am 13. Januar diesen Jahres die
CSCL GLOBE auf ihrer Jungfernfahrt im Hamburger Hafen fest macht und
als der neue Gigant der Meere gefeiert wird ‒ der Containerriese der
Großreederei CSCL (China Shipping Container Lines) hat eine Länge
von 400 Meter, eine Breite von 59 Meter und die Stellplatzkapazität
von unfassbaren 19.100 Standardcontainer (TEU-Twenty-foot Equivalent
Unit), verlässt im gleichen Zeitraum und medial eher unbeachtet die
MSC OSCAR ihre Werft in Südkorea und stößt mit einer
Stellplatzkapazität von 19.224 TEU die aktuelle Königin schon wieder
vom Thron. Sie ist zwar um 4,5 Meter kürzer als ihre Vorgängerin,
aber TEUs sind TEUs. Es lebe die neue Königin der
Containerschifffahrt! Lange wird ihre Regentschaft wohl nicht
dauern, sie steht aber dennoch an der Spitze einer Entwicklung, die
Ihren Anfang in den 1950er Jahren in den USA nahm.
Ohne Zweifel gilt der Containertransport
unter Experten als die wichtigste Transport-Revolution des 20.
Jahrhunderts. Mitte der 1950er Jahre stellte die Bewältigung der
rasant gewachsenen Gütermenge im internationalen Warenaustausch für
die Logistikbranche eine gewaltige Herausforderung dar. Die
Abwicklung der Güter, die sich in Größe und Gewicht stark
unterschieden, war zeitintensiv und benötigte viel Arbeitskraft.
Gleichzeitig stiegen in den westlichen Industriestaaten die Löhne,
was zu Kostensteigerungen führte. Eine Lösung des Problems musste
rasch gefunden werden.
Der US-amerikanische Transportunternehmer
und spätere Reeder Malcom McLean entwickelte die Idee, statt
einzelne Güter in Form von Kisten oder Säcken vom LKW bzw. dessen
Auflieger zu entladen und dann wieder mühevoll auf ein Schiff zu
laden, den ganzen Auflieger als Einheit zu verschiffen und am
Zielort wieder auf eine Zugmaschine zu setzen.
Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, andere
Reedereien von seiner Idee zu überzeugen, verkaufte er 1955 seine
Anteile an seinem Transportunternehmen McLean Trucking Company und
übernahm die Reederei Waterman Steamship mit ihrem
Tochterunternehmen Pan-Atlantic Steamship (1960 wurde sie in
Sea-Land Service umbenannt). Um seine Idee zu verwirklichen, baute
er einen gebrauchten Tanker, den er zuvor von der US Marine gekauft
hatte, so um, dass sich auf der dafür gefertigten Deckskonstruktion
Trailer, anfangs mit und später dann ohne Fahrgestelle, stauen
ließen.
Am 26. April 1956 stach das auf den Namen
IDEAL X getaufte Schiff von Port Newark (New Jersey) nach Houston
(Texas) in See und machte die Reise somit zur Jungfernfahrt des
Containertransports. Nach anfänglicher Zurückhaltung entschlossen
sich Ende der 1950er Jahre auch andere Reedereien der USA das Erfolg
versprechende Transportsystem zu testen.
Mit der Zeit wurde es aber dringend
notwendig, einheitliche Maße für die Boxen festzulegen, damit sie
unabhängig von der jeweiligen Reederei auf den dafür ausgerüsteten
Schiffen Platz hatten. Die Maße wurden 1964 von der Internationalen
Organisation für Standardisierung auf eine Länge von 20, 30 und 40
Fuß und einer Breite und Höhe von 8 Fuß festgelegt. Heutzutage haben
sich im internationalen Seeverkehr die 20 und 40 Fuß Container
durchgesetzt. Ein weiteres Merkmal der Standardisierung waren und
sind bis heute die Eckbeschläge der Container. Sie gewährleisteten,
dass die Container in jedem Hafen weltweit von den Umschlagbrücken
gleich angefasst bzw. mit den jeweiligen Transportträgern verriegelt
werden können ‒ eine unerlässliche Maßnahme, um einen
Transportbehälter für ein internationales intermodales Verkehrsnetz
zu konstruieren.
1966 brachten die amerikanischen Reedereien
mit einem Containerliniendienst ihr neues Transportsystem über den
Atlantik nach Europa. Die ersten Schiffe waren noch
Semi-Containerschiffe, doch im Mai desselben Jahres erreichte die MS
FAIRLAND als erstes Vollcontainerschiff von Malcom McLeans Reederei
Sea-Land Service, beladen mit 255 Boxen, Bremen.
Mit der BELL VANGUARD lief am 26. März 1966
das erste deutsche Containerschiff mit einer Stellplatzkapazität von
67 TEU vom Stapel. Es wurde in der Sietas-Werft in Hamburg gebaut
und stand im Dienst der Hamburger Reederei J. Breuer.
Der Containerliniendienst über den
Nordatlantik nach Nordwesteuropa war nur der Anfang für ein
weltumspannendes Logistiknetz, das rasch neue Fahrtgebiete eroberte.
Bis Ende der 1960er Jahre etablierte sich der Containerverkehr über
den Pazifik zwischen Europa und Australien bzw. Neuseeland und
Anfang der 1970er Jahre zwischen Nordamerika und Australien bzw.
deren benachbarten Inseln. Die dänische Reederei Maersk Line
kooperierte 1968 mit der Kawasaki Line, um einen Liniendienst in den
fernen Osten zu starten, in Deutschland vereinigten sich Hapag und
Lloyd und starteten mit der WESER EXPRESS den ersten europäischen
|
|
Vollcontainerdienst nach New York. Auch in
Asien wurde eine der heute weltweit größten Reedereien gegründet.
Aus der 1947 in Shanghai (China) als Orient Overseas International
Ltd. gegründeten Reederei entstand 1969 die Orient Overseas
Container Line (OOCL) mit Sitz in Honkong. Ein Jahr davor war die
Evergreen Marine Corp. Ltd. mit Sitz in Taipeh (Taiwan) ins Leben
gerufen worden, heute einer der fünf größten
Containerschiff-Reederei der Welt.
Unter der Schirmherrschaft der UN / IMO
(International Maritime Organisation) fand Ende 1972 eine
internationale Konferenz über den Containerverkehr in Genf statt. Am
2. Dezember wurden zwei internationale Abkommen beschlossen, die für
die weitere Entwicklung des Containerverkehrs von entscheidender
Bedeutung waren: Die „International Convention for Safe Containers
(CSC)” und die „Customs Convention on Containers (CCC)” regeln
seitdem Fragen der Sicherheit sowie des Zollrechts im
internationalen Containerverkehr.
Der unaufhaltsame Aufstieg der
Containerschifffahrt ‒ die Containerflotte ist bis zum heutigen Tag
in Bezug auf ihre Tragfähigkeit, sowie auf ihre Größe, der Flotte
der Öltanker und Massengutschiffen weit unterlegen ‒ und die damit
einhergehende Containerisierung der wichtigsten Handelsrouten trug
viel zur Globalisierung der Wirtschaft bei. Die Idee, Güter in einen
Standardcontainer mit einer Länge von 20 Fuß und einer Breite und
Höhe von etwa 8 Fuß zu packen, war genial. Das einmalige Verpacken
und der anschließende Transport über lange Distanzen auf
verschiedenen Verkehrsträgern (Schiff, Bahn, LKW) sparte enorm
Transportkosten. Die Liegezeiten der Schiffe in den Häfen wurde
deutlich verkürzt, Hafengebühren für das Lagern und Verstauen
sanken. Die größte Ersparnis war und ist wohl der Transport auf See
selbst. Durch immer größere und schnellere Schiffe sanken die Kosten
pro Tonne-Seemeile und halfen dabei, ganze Produktionsprozesse aus
Hochlohnländern der industrialisierten Welt in
Niedriglohnländer zu verlagern.
Die Schattenseiten dieses effizienten
Systems sollten jedoch nicht unbeachtet bleiben. In gleichem
Zusammenhang vernichtete es seit seiner Entstehung, angefangen vom
Hafenarbeiter bis zum Arbeiter in Produktionssystemen der
industrialisierten Welt, unzählige Arbeitsplätze.
Seit 1985 verzeichnete der Gütertransport
in Containern auf See Zuwachsraten von rund 10 Prozent jährlich. Mit
der gleichzeitig stetigen Vergrößerung der Containerflotte stiegen
nicht nur die Investitionskosten für Neubauten, sondern auch die
Kosten für Schiffstreibstoffe (Bunkeröl). Die Zuwachsraten beim
Ölpreis lagen von 1982 bis 2007 bei durchschnittlich 11 Prozent.
Zusätzlich stiegen aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Personal die
Lohnkosten, was Mitte der 2000er Jahre bei steigendem
Ladungsaufkommen zu deutlichen Erhöhungen der Frachtraten führte.
Die Importflut aus China, hauptsächlich auf der Europa-Asien Route
sowie der Transpazifik Route, brachte zusätzlich die
Umschlagskapazitäten der Haupthäfen in Europa und an der
amerikanischen Westküste an Ihre Grenzen.
Aber das neue Jahrtausend war nicht nur vom
starken Flottenzuwachs und der Vergrößerung der Stellplatzkapazität
geprägt – von 1975 bis heute stellte alleine die dänische Reederei
Maersk 5 mal die Siegerin im Rennen der größten Containerschiffe der
Welthandelsflotte. Übernahmen machten einzelne Reedereien immer
größer, die somit den größten Teil der Stellplatzkapazität stellten.
Anfang 2000 verfügten die 10 größten Reedereien über etwas mehr als
49 Prozent der Stellplatzkapazität, 2006 waren es schon 60 Prozent,
was rund 6 Millionen TEU entsprach.
Bis zum heutigen Tag befindet sich die
dänische Reederei Maersk, mit einer Flotte von mehr als 600 Schiffen
und der sagenhaften Stellplatzkapazität von über 2,9 Lillionen TEU,
unangefochten an der Spitze der Containerreedereien. In Ihrem
Gefolge befinden sich illustre Namen wie die Mediterranean Shipping
Co (MSC), die CMA CGM Group, Hapag-Lloyd und die Evergreen Line.
Doch die Zahlen können über eine Tatsache
nicht hinwegtäuschen. Die Containerbranche steckt, spätestens seit
Ausbruch der globalen Finanzkrise, in Schwierigkeiten. Überkapazität
an Frachtraum, einbrechende Wachstumsraten und ein hoher
Konkurrenzdruck ‒ das alles drückt auf die Frachtraten und die
Erträge der Reedereien. Nach der Krise halbierten sich die
Zuwachsraten auf 4 bis 5 Prozent jährlich.
Um weiter konkurrenzfähig zu bleiben, hilft nur die Flucht nach
vorne. Das bedeutet Fusionierungen zwischen den Reedereien und der
Bau größerer Schiffe. So paradox das bei bestehenden Überkapazitäten
klingen mag, doch ein großes Schiff das langsam fährt, wenig
verbraucht und dabei viel transportiert, spart Kosten und hilft bei
sinkenden Frachtraten mehr zu verdienen als nur die Tankrechnung.
Thomas Jantzen (Text + Foto)
|
|
|
|
 |
|
|

Eisbrecher SAMPO im Ostsee-Eis vor Kemi.
Foto: nordicpress, Vuokatti (FIN) |
|
|
Eis-Theater am Polarkreis
Auf Tagestörn mit einzigem
Passagiereisbrecher der Welt
|
|
|
|
Mühsam kriecht der Sonnenball über den vom Wald
gezackten Horizont – und bleibt dort kleben. Zu höheren Kletterkünsten
reicht ihre polarnächtliche Kraft nicht. Wohl aber für jungfräuliches Eis in
der Bottenvik, im nördlichsten Zipfel der Ostsee. Saisonbeginn für SAMPO.
Samen in traditionell-bunter Tracht schenken heißen
Multbeeren-Tee aus. Schließlich gilt es, die frierenden Polarfahrer auf das
eiskalte Abenteuer einzustimmen. Das sie in der südlichen Ostsee in diesem
Winter vergeblich suchen.
Über dem Hafen der nordfinnischen Stadt Kemi
schwebt eine ganz besondere „Duft”-Wolke: Der Kenner tippt auf Zellulose.
Stichwort Papier: Davon lebt man hier am Bottnischen Meerbusen. Weithin
sichtbar die wolkenhohen Dampfschwaden.
200 Millionen Tonnen Zelluloseprodukte verlassen
dort jährlich die Fabrikhallen. 85 Prozent werden über See exportiert.
Unentbehrlich dabei modernste Eisbrecher. Sie brechen den Frachtern winters
(von November bis Mai) die Bahn. Unsere SAMPO ist nach dreißig Jahren
Eiseinsatz entbehrlich geworden: zu schwach auf der Brust, technisch
veraltet und zu schmal für die immer breiter ausladenden Papiertransporter.
Winter-Knüller
Touristisch hat die 20.000-Einwohner-Papierstadt
Kemi im lappländischen Winter keine ausgesprochenen „Knüller” zu bieten –
außer der größten zusammenhängenden Eisfläche Europas vor ihrer Haustür und
einen Eisskulpturen-Park. Die Stadtväter haben sich noch etwas
Bemerkenswertes einfallen lassen: Kurzerhand kauften sie der finnischen
Seefahrtsbehörde den Eisbrecherveteran SAMPO ab, bewahrten ihn damit vor dem
Hochofen und funktionierten das technische Denkmal zum weltweit einzigen
reinen Passagiereisbrecher um.
Damit nicht genug. SAMPO heißen zwar viele
finnische Männer, aber auch die Maschine, die im Volksepos „Kalevala” (Geld)
herstellt. Aus der klimatischen Not ist eine touristische Tugend geworden.
Seitdem lockt der schwarz-gelbe Stahlkoloss allwinterlich Eis(brecher)-Fans
aus aller Welt nach Kemi – und zieht ihnen das Geld aus der Tasche.
Exklusiv ist das Vergnügen allemal. Sogar erklärte
„Frostbeulen” geraten ins Schwärmen, wenn die 8.800 Pferdestärken des
schmucken 3.450-Tonners unter ihren Füßen zu vibrieren anfangen.
Schauer über den Rücken
Krachend, knackend, knirschend und knisternd kämpft
sich der bullige Kraftprotz durch das bis zu einem Meter mächtige Eis aus
dem Hafen. Der abgeknickte Steven schneidet sich durch das beinharte
Element. An den SAMPO-Flanken schaben die zerborstenen Schollen entlang,
stellen sich wie aus Protest sekundenlang senkrecht, um dann ohnmächtig
klatschend in die frisch gepflügte Fahrrinne zurückzugleiten.
Die Brücke ist gerammelt voll. Jeder will den
Eispiloten beim Navigieren über die Schulter sehen. Auf der Back recken
anscheinend kälte- und windresistente Seh-
|
|
Leute ihre Hälse nach unten, um das
Eisbrechspektakel hautnah beobachten zu können. „Das jagt mir regelrecht
wohlige Schauer über den Rücken”, strahlt mein Nebenmann vor Begeisterung.
Und selbst sonst so „coole” Banker geraten schier aus dem Häuschen:
„Unglaublich faszinierend, dieses Eis-Theater!” Obwohl den „Verrückten”
spitze Eisnadeln das Gesicht röten, noch verstärkt durch die gleißende
Lichtbahn der am frühen Nachmittag untergehenden Sonne.
Herzensbrecher und Eis-Schlachtschiffe
Von Eisbarrieren, die der Wind aufgeschoben hat,
und verbackenem Treibeis wird SAMPO schon mal gestoppt. Mit Anlauf und
geballter Kraft werden auch solche Hindernisse geknackt, ein besonderes
Erlebnis für die Eisbrecher-Passagiere. „Ein Schauspiel, das seinesgleichen
sucht”, entfährt es spontan einer zierlichen, kleinen Frau, die sonst gar
nichts von solchen Abenteuern gehalten hat. Ein Geschäftsmann hingegen: „Ich
habe nicht viel Zeit für größere Reisen, aber das hier ist eine tolle
Alternative.”
Der „Herzensbrecher mit der rauhen Schale” (so eine
Broschüre) nimmt den Rummel auf seine alten Tage gelassen. Schließlich
werden seit 1877 „Schlachtschiffe gegen den nordischen Winter” in Finnland
gebaut, deren stärkste 33.000 diesel-elektrische PS ins Eis bringen. Sechzig
Prozent aller Eisbrecher dieser Welt stammen von finnischen Werften,
insbesondere der Wärtsilä-Masa-Yards-Schmiede in Helsinki (auch
Spitzenprodukte der Kreuzschifffahrt stammen da her).
Wir passieren die NORDICA, einen der modernsten finnischen
Großeisbrecher, der auf einen Frachter-Konvoi wartet. Geradezu futuristisch
wirken seine Linien; kein Vergleich zur musealen, aber gemütlichen SAMPO.
Polar-Schwimmer
Höhepunkt des eisigen Ein-Tages-Törns: wenn Kapitän
Janni Lamila zum Badevergnügen – richtig gelesen! – am frostigen Busen der
Natur lädt. Keine Angst, denn die mutigen Polar-Schwimmer zwängen sich erst
einmal in knallrote Gummianzüge, die ein sechsstündiges Überleben im
Eiswasser, auch für Nichtschwimmer, garantieren (ohne diesen Schutz wären es
nur qualvolle Minuten). In ungelenker Pinguinmanier watscheln die
Freiwilligen die Gangway abwärts auf das rutschige Eis. Vor Lust kreischend,
plumpsen sie in das aufgebrochene Kielwasser, von oben bestaunt und
fotografiert von den weniger Mutigen. Da strampeln sie nun wie aufgeblasene
Frösche auf dem Rücken liegend und genießen die eisige Badeshow, eifrig
versichernd, wie „warm” ihnen doch sei.
Im stilechten Salon aus Edelholz und Messing dampft
schon eine köstliche Dill-Lachssuppe zum Aufwärmen.
Beim Abschied drückt uns der SAMPO-Kapitän
höchstpersönlich ein „Diplom” in die Hand. Das ist d e r
Beweis: Wir sind Zeugen des Eis-Theaters am Polarkreis gewesen.
Dr. Peer Schmidt-Walther
Info:
Zu buchen direkt bei :Sampo Tours, Torikatu 2, FIN-94100 Kemi; Telefon
+385-16-256 548. sampo@kemi.fi
·
www.sampo-tours.com
|
|
|
|
|

Berstendes 50-Zentimeter-Festeis.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund
|
 Finnischer
Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi. Finnischer
Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund
|
|
|
|
 |
|
|

Seelotse Jens Mauksch vor MS STAVFJORD im
Südhafen. Foto: Dr. Peer
Schmidt-Walther, Stralsund
|
|
|
|
MS STAVFJORD kam durch
Mit Stralsunder Gold durch den Graben
gerutscht
|
|
|
|
Tiefgangsbeschränkungen in der Stralsunder
Ostansteuerung, der Hauptverkehrsader des Hafens, ließen kürzlich
aufhorchen. Bislang durften Schiffe bis zu 6,50 Meter tief eintauchen, jetzt
nur noch 5,90 Meter bei Tag und 5,80 bei Nacht. PSW fuhr mit der STAVFJORD
raus.
Schauplatz Südhafen. Schiffsmakler Thorsten Müller
„verkleidet” sich, indem er seinen orangefarbenen Overall überzieht.
Seelotse Jens Mauksch aus Devin, seit 13 Jahren im Geschäft, stakt durch das
gelbe Gips-Schneematsch-Gemisch am Schiff entlang und liest an Heck und
Steven die Tiefgänge ab. „Na ja”, meint der erfahrene Seemann, „geht man
gerade so”. Plötzlich rollt der schwere bordeigene Bagger auf Schienen
Richtung Vorschiff. „Um durch die Gewichtsverlagerung den Tiefgang von
achtern nach vorn auszugleichen”, erklärt Mauksch.
Schon 30 Prozent größere Schiffe
Kurze Begrüßung auf der Brücke. Der norwegische
Kapitän Per Helge Kaland aus Bergen und sein Zweiter Offizier Richard
Calleja von den Philippinen geben kurz Auskunft über Schiff und Zielhafen,
wie das so üblich ist. „Mit 5800 Tonnen Gips via Nord-Ostsee-Kanal nach
Immingham in Ost-England”, informiert Kaland, „200 Tonnen weniger als
geplant”. Während Mauksch ihm die beschränkte Situation im Fahrwasser
erklärt, startet der Zweite die Kaffeemaschine. Kaffeeduft verdrängt
allmählich Tabaksgeruch.
„‚Stralsunder Gold’ im Bauch”, grinst Mauksch, „denn
Gips ist mit 575.000 Jahrestonnen unser Standbein”. Der Hafen sah schon
seine Felle davon schwimmen. Nachdem jahrelang dafür getrommelt wurde,
größere Schiffe an den Sund zu holen, habe man sie jetzt, aber mit
geringerer Auslastung. Seehafen-Chef Sören Jurrat versteht die Welt nicht
mehr, „denn größere Schiffe mit bis zu 6,50 Meter Tiefgang machen immerhin
schon dreißig Prozent der Anläufe aus”.
Unbürokratische, schnelle Hilfe
Kaland schaut jetzt auf die Brückenuhr: „Let’s go!”,
gibt er locker das Kommando. Über Walkie-Talkie verständigt er „seine Jungs”
unten an den Winden. Auf der Pier streift Thorsten Müller die Leinen von den
Pollern.
|
|
Kurzer Gruß auf die Brücke: „Alles klar!”
Schwerfällig dreht der 114 Meter lange, 15 Meter breite norwegische
6000-Tonner STAVFJORD unter niederländischer Flagge nach Steuerbord.
An Backbord hat vor der Ziegelgrabenbrücke gerade ein
kleiner dänischer Bagger festgemacht, der dabei von einem
NDR-Nordmagazin-Team gefilmt wird. WSA-Chef Holger Brydda hat prompt
reagiert und den Schaufler kurzerhand von der Peene abgezogen. „Damit können
wir unbürokratisch kurzfristig helfen”, sagte der Leitende Technische
Regierungsdirektor noch beim Nautischen Essen am Freitag, „wir wollen ja dem
Hafen keinen Schaden zufügen”. Zunächst sei der Ziegelgraben dran, in dem es
durch strömungsbedingte Sandeintreibungen von der Ostseeküste her
Mindertiefen gebe. 7,50 Meter ist für die Fahrrinne garantiert, so dass noch
ein Meter Luft nach oben für den Tiefgang bleibt.
Auf Sicherheit gehen
Jens Mauksch schaltet das Echolot ein, um zu sehen,
wo es „patches”, wie er die Sandhügel nennt, gebe. Das Gerät zeigt 2,50
Meter und mehr an. „Kein Problem”, strahlt Jens Mauksch beruhigt, „wenn du
Mitte Bach steuerst und mit maximal sieben Knoten schleichst”. Man dürfe nur
nicht an die Seiten kommen, „da wird’s dann problematisch und man kann sich
festfahren”. Selbst in der als kritisch eingestuften Palmerort-Rinne am
Ausgang in den Greifswalder Bodden und im Landtief-Fahrwasser südöstlich von
Thiessow meldet das Echolot noch 1,50 Meter unterm Kiel. „Selten ist
außerdem eine Begegnungssituation unter großen Schiffen”, weiß Mauksch aus
langjähriger Revier-Erfahrung. Auch er wünscht sich dringend eine Vertiefung
der Nordansteuerung nicht nur für Frachter, denn „die ist mit zwei Meter
Tiefgangsbeschränkung selbst für manchen Segler schon ein Problem”.
„Wir müssen auf Sicherheit gehen”, begründet Holger
Brydda den behördlichen Schritt. Ein Argument, dem sich niemand entziehen
kann.
Nach dreieinhalb Stunden und 28 Seemeilen kommt das
Freester Lotsenboot KLAASHAHN längsseits. Wir wünschen Kapitän Per Helge
Hansen und seiner siebenköpfigen Crew gute Reise und hoffen: „bis zum
nächsten Mal in Stralsund!”
Dr. Peer Schmidt-Walther
|
|
|
|
 |
|
|

Hochseebagger IDUN R im Greifswalder Bodden.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund |
|
|
|
In vier Wochen 100 mal nach Drigge
Ostansteuerung um rund 70.000 Kubikmeter
Schlick erleichtert
|
|
|
|
Stralsund – Seit dem 5. Februar war der dänische
Hochseebagger unter holländischer Flagge IDUN R auf dem Sund im Einsatz. Die
Versandung der Fahrrinne verlangte ein schnelles Handeln. Im Schichtdienst
rund um die Uhr sorgte die Besatzung endlich wieder für klare Verhältnisse.
Mühsam kriecht die Sonne an diesem 6. März durch
letzte Nebelwolken über dem Spülfeld der Halbinsel Drigge. Für die IDUN R
ist das schon fast zur zweiten Heimat geworden. Hier legte sie an, wenn sie
ihre Ladung aus grauem Schlick und Sand aus der Ostansteuerung loswerden
wollte. Noch 750 Tonnen schwappen jetzt als Ballast und „Sund-Souvenir” im
Laderaum des Hopper-Baggers. In einem Stahlkasten winden sich 20 fette Aale.
„Leckerer Beifang zum Räuchern”, wie Kapitän und ehemaliger Hochseefischer
Peter Högenhaul erklärt, „die gehen auch mit nach Dänemark”.
Gravierender Nachteil
Weil die Unterwasser-Böschungen im Laufe der Zeit
nachgaben und ihre Massen in die Fahrrinne drückten, musste das Wasser- und
Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) unbürokratisch aktiv werden. „Sicherheit und
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs”, wie das die Vorschriften fordern, waren
nicht mehr garantiert. Statt 6,50 durften Schiffe bei Tagfahrt nur noch 5,90
Meter eintauchen. Mit der Folge, dass weniger Ladung verfrachtet werden
konnte. Manchmal pro Frachter mehrere hundert Tonnen, ein gravierender
ökonomischer Nachteil.
Peilungen und Restarbeiten
Die dänische Baggerei Rohde Nielsen A/S erhielt den
500.000-Euro-Zuschlag, auch weil ihre IDUN R sofort verfügbar war. Zwischen
der Landtiefrinne im Südosten Rügens und dem Ziegelgraben hat der 79 Meter
lange 2772-Tonner den 23 Seemeilen-Weg ausgeputzt. „Nach abschließenden
Peilungen und Restarbeiten durch einen kleineren Bagger”, erklärt Lotse Jens
Mauksch, der an diesem Morgen zum letzten Mal Kapitän Peter Högenhaul berät,
„wird das Fahrwasser wieder freigegeben”. Im Sommer 2016 sollen noch einmal
über 700.000 Tonnen gebaggert werden.
Nordansteuerung längst überfällig
Auch die immer stärker versandende Nordansteuerung müsste, fordert der
erfahrene Seelotse in diesem Zusammenhang, endlich ausgebaggert werden:
„Statt 3,70 Meter
|
|
dürfen Schiffe hier nur zwei Meter tief
eintauchen, ein Unding!” Frachter in Ballast können da nicht mehr
durchfahren, sind um Rügen fünf Stunden länger unterwegs, verbrauchen mehr
Kraftstoff, sind abhängig von den Brückenzeiten und verursachen 50 Prozent
mehr Lotskosten, rechnet Mauksch vor. Das schadet dem Hafen genauso wie dem
Segeltourismus, klagt er, „würde man das Problem zügig anpacken, kämen auch
wieder mehr Schiffe”. WSA-Chef Holger Brydda sieht das Land in der Pflicht,
aber die Schweriner überzeugt seine Kosten-Nutzen-Rechnung nicht ‒ auch wenn
die Rinne immer weiter versandet und das Baggern, schon jetzt in
Millionenhöhe, noch teurer werden würde.
Stralsund geschrumpft
Nach einem kräftigen Frühstück – der Koch wünscht
„well bekomm! Guten Appetit!” ‒ in der gemütlichen Messe klettern Högenhaul
und Mauksch auf die Brücke. Kaffeeduft und Kapitäns-Pfeifenschwaden sorgen
fast schon für Gemütlichkeit, während die beiden Seeleute sich entspannt –
„easy, easy!” – über das Ablegemanöver verständigen. Sie kennen sich aus
vielen gemeinsamen Bagger-Schichten, die jeweils zwölf Stunden gedauert
haben.
„Leggo! Leinen los!” Die 2283-kW-Maschine grummelt im
„Keller”. Abschied von Stralsund, dessen Kulisse im Kielwasser langsam auf
Spielzeuggröße schrumpft, ein letztes Mal vorbei an Drigge.
Zum Karneval nach Rio
Auf den bunten Displays ist die saubere
Schürfarbeit von IDUN R deutlich zu sehen und abzulesen. Auch das Echolot
zeigt wieder die alten Werte. „Gute Arbeit!”, ist man sich auf der Brücke
einig, nicht zuletzt dank einer ausgefeilten Bagger- und zentimetergenauen
Anzeigetechnik.
Die weiß man auch in Brasilien und Afrika zu
schätzen, erfährt man vom Kapitän, „dahin sind wir mit unserem kleinen, aber
seetüchtigen Schiff schon fünf Mal über den Atlantik gefahren”. In Rio habe
er beim Karneval sogar seinen Geburtstag gefeiert. Jetzt freuen sich die
Dänen auf ihren nächsten Job in Esbjerg, das sie durch den Nord-Ostsee-Kanal
ansteuern: „Da sind wir fast schon zu Hause”.
Von Freest prescht das orangefarbene Lotsenboot
KLAASHAHN heran. Zeit zum Abschiednehmen. „Thank you for good cooperation”,
bedanken sich die Seeleute gegenseitig, „bis zum nächsten Mal in Stralsund –
hoffentlich zur Ausbaggerung der Nordansteuerung!” Dr. Peer
Schmidt-Walther
|
|
|
|
|

Kapitän (links) mit Seelotse im Fahrstand.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund
|
|
 Im
Pumpenraum unter der Back. Im
Pumpenraum unter der Back.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund
|
|
|
|
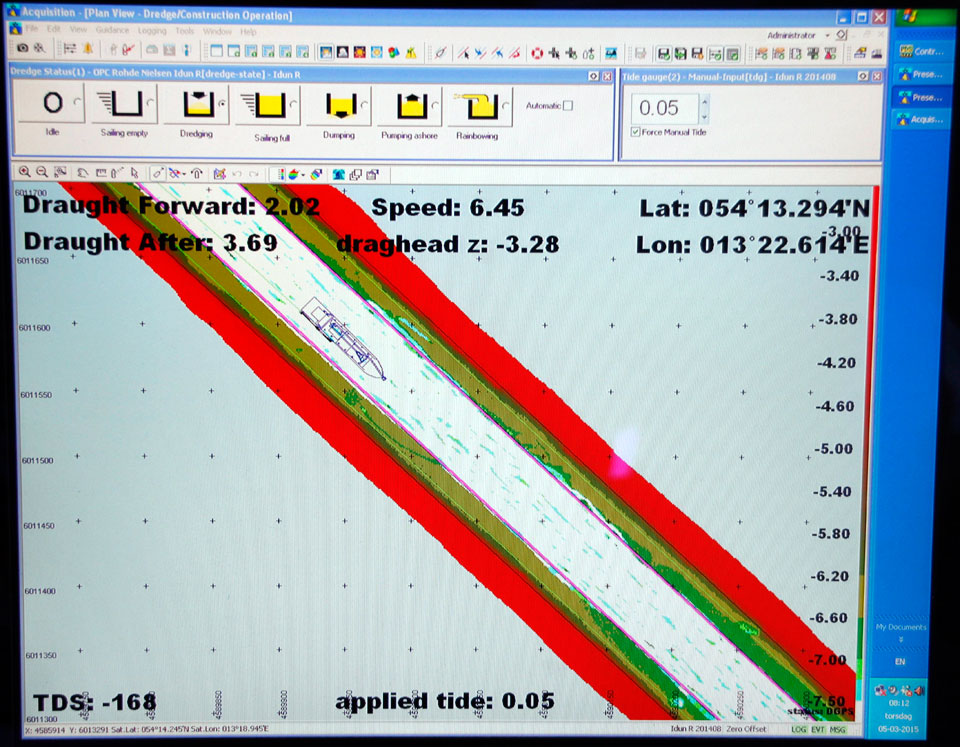 Fahrrinne
mit Bagger und flacherer Kante.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund Fahrrinne
mit Bagger und flacherer Kante.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund |
|
|
 |
|
|

 Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die
Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm
der Entrüstung gesorgt.
Foto: Kai Ortel, Berlin
Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die
Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm
der Entrüstung gesorgt.
Foto: Kai Ortel, Berlin






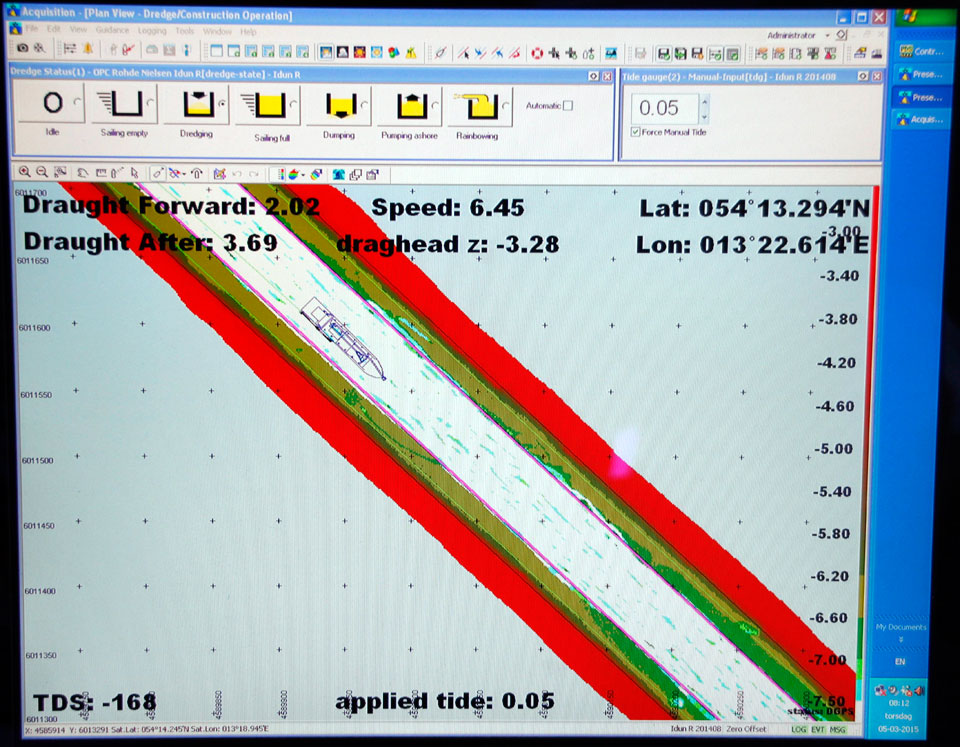 Fahrrinne
mit Bagger und flacherer Kante.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund
Fahrrinne
mit Bagger und flacherer Kante.
Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund









 Finnischer
Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.
Finnischer
Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.
 Im
Pumpenraum unter der Back.
Im
Pumpenraum unter der Back.