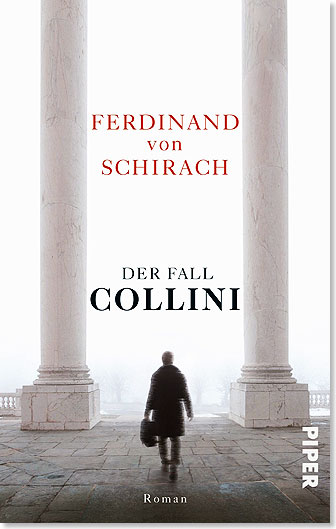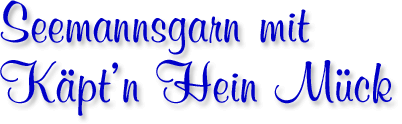|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Von Ende Juni bis Anfang September steht Wolfgang Lippert wieder als Sänger der „Störtebeker-Festspiele” fast täglich auf der Freilichtbühne in Ralswiek auf Rügen. Foto: Störtebeker Festspiele, Ralswiek
Mit Wolfgang Lippert an Bord
In Ralswiek auf der Insel Rügen habe ich mit dem Musiker, Entertainer und Moderator Wolfgang Lippert gesprochen, der auf einen Kaffee-Sprung an Bord der SAXONIA gekommen ist. Von Juni bis September steht er hier als Sänger auf der in Sichtweite liegenden Freilichtbühne der bekannten „Störtebeker-Festspiele”. Der wassersportbegeisterte Barde und Bootseigentümer lebt zudem gleich um die Ecke des idyllischen Spielortes. PSW: Wolfgang, Du bist in Deinem Leben viel herumgekommen. Was hat Dich am meisten beeindruckt, was fehlt noch in Deiner Sammlung? Lippert: Na ja, ich war schon mal am anderen Ende der Welt, also wenn man mal so von oben nach unten durchbohrt. Australien und Neuseeland haben mich sehr beeindruckt. Unvergesslich, die faszinierenden Galapagos Inseln mit Ihrer Ursprünglichkeit und der endemischen Tierwelt. Bis auf Süd-Ostasien haben meine Frau Gesine und ich fast alle wichtigen Highlights dieser Erde gesehen. PSW: Alles per Schiff? Lippert: Nicht unbedingt. Meine ersten Reisen hatten ja mit meinem Beruf zu tun, die gingen vornehmlich ins sozialistische Ausland. Woanders durften wir aus der DDR ja nicht hin; aber durch die Kultur, vor allem die Musik, war ich damals schon in der Sowjetunion. Es ging bis zur chinesischen Grenze, wo völlig andere Bedingungen herrschten, sogar ab und zu mal ein Dorf verschwand auf irgendeiner Seite und wo eigentlich immer so ein bisschen Kriegszustand herrschte. Das war unterschwellig auch nicht ganz ungefährlich. Später dann, nach der Wende ‒ wiederum durch meine Arbeit bedingt ‒, war ich z.B. auch sehr oft in Amerika. PSW: Du sagst, durch Deine Arbeit. Wie sah die denn aus während dieser Reisen? Lippert: Ich habe eine gehörige Zeit für das ZDF gearbeitet; da gab es eine Sendung, die hieß „Wintergarten”, mit der sind wir verreist. Es kam damals relativ neu auf, dass Fernsehsender mit Reiseveranstaltern kooperierten. So haben wir immer eine Anzahl von Fans, die diese Sendung mochten, zusammen gesammelt ‒ manchmal waren das 300 bis 400 Leute. Mit denen sind wir dann irgendwo hingefahren; verbunden war das mit einem Preisausschreiben. PSW: Wenn ich Dein buntes Leben Revue passieren lasse, frage ich mich, ob Du schon als Kind oder Jugendlicher den Drang verspürtest, die Welt über die Grenzen der DDR hinaus zu sehen? Lippert: Sagen wir mal, richtige oder tiefe Sehnsucht in die Welt hinein, die hat man natürlich immer dann, wenn man Literatur liest, zum Beispiel damals Karl May. Diese Sehnsucht war bei uns ein bisschen größer als anderswo, weil wir ja nicht die Möglichkeit hatten, uns alles anzuschauen. Das ging erst später los, sozusagen als Nebenfolge meiner Arbeit. PSW: Was fasziniert Dich eigentlich an Seereisen? Lippert: Eine Seereise hat deshalb eine besondere Qualität, weil man ja das Ufer verlässt, auf dem besonderen Ort Schiff lebt und damit quasi unerreichbar ist. Faszination übt auch die moderne Schifffahrt auf mich als Segler aus, die nach wie vor den Launen der Natur ausgesetzt ist. Außerdem hat man sein Hotelzimmer immer |
dabei, ein großer Vorteil. Wenn man in einer neuen Stadt ist, muss man nicht jedes Mal den Koffer ein- und auspacken, sondern hat als Ausgangspunkt diese mitreisende Kabine und kann sich von da aus alles erobern. Dann finde ich, dass eine Seereise eine gute Möglichkeit bietet, sich einen Überblick zu verschaffen über die Orte, die man später vielleicht in Ruhe noch mal näher kennen lernen möchte. PSW: Nun hast Du eben gesagt, eine Seereise habe etwas Uferloses, man sei losgelöst vom Land. Diese Uferlosigkeit gibt es bei einer Flussreise ja nicht. Lippert: Also, auch wenn man mal stromab- und mal stromauf gefahren ist, muss das trotzdem nicht das Gleiche sein. Was man auf der Hinfahrt nicht sehen konnte, weil es Nacht war, bekam man dafür auf der Rückreise geboten. Jeder Stromkilometer bietet neue Ausblicke, ganz anders, als wenn man auf hoher See ist und rundum nur Wasser sieht. Auf dem Fluss ist man dagegen in ständigem Kontakt mit der Natur. PSW: Es gibt ja dieses Wort von der Langsamkeit, mit der man sich hier fortbewegt. Ist das auch ein Reiseaspekt für Dich? Lippert: Ja, denn wir leben heute in einer sehr schnellen Welt. Man bewegt sich auf dem Fluss, ich schätze mal, so mit 20 bis maximal 30 Stundenkilometern durch die Gegend wie im Radfahrertempo. Das hat eine geradezu beruhigende Wirkung, so dass man auch sein eigenes Tempo für diese Zeit reduziert. Auch wenn man Tempo mag, aber das Leben besteht nun mal aus Kontrasten. PSW: Kannst Du Dich nach langen, kräftezehrenden Auftritten bei den „Störtebeker-Festpielen” auf Rügen zu Hause gut regenerieren? Lippert: Absolut! Während einer wirklich anstrengenden Zeit von 68 Spieltagen vor täglich 6.000 bis 9.000 Menschen. Das macht zwar wahnsinnig viel Spaß, aber man muss eben auch versuchen, als Künstler auf der Bühne den Letzten in der letzten Reihe zu erreichen. So was kostet viel Konzentration und Kraft. Deswegen ist zwischendurch eine Erholungspause, ob zu Hause, in der Natur oder per Boot auf dem Wasser, immer mal wieder dringend nötig. PSW: Wie gehst Du damit um, wenn Dich Leute erkennen? Lippert: Es ist natürlich schön, wenn Menschen dich erkennen als der, der du bist, als Fernsehmensch, als Kulturmensch, als Freudespender ‒ und wenn man diese Dinge auch mal zurückgesagt bekommt. Fernsehen, und damit habe ich die meiste Zeit des Lebens verbracht, ist ja anonym, wenn man so will. Man sieht seine Zuschauer nicht, aber es ist dann doch schön, wenn man fühlt, dass man sie berührt hat. In dieser schnelllebigen Zeit, wo Personen, Formate und Sender so schnell weg sind, dass man kaum noch hinterherkommt, ist es schon etwas Besonderes, wenn man bei den Menschen haften bleibt. Wenn man nicht nur gesagt bekommt, „ich hab’ Sie dort und dort gesehen”, sondern „Sie haben mich berührt, Sie haben mir über dieses oder jenes hinweggeholfen und deswegen mag ich Sie”. Darüber freue ich mich sehr. PSW: Du bist ein bekannter Entertainer, aber „Lippi”, wie Du überall heißt, ist Mensch geblieben. Wie schafft man das eigentlich? Lippert: Es gibt ja ein Leben neben der Kamera, außerhalb des Mediums, und da ist man eben ein völlig normaler Mensch. So ganz normal ist das zwar auch wieder nicht, weil man bekannt ist, weil Leute auf dich reagieren und du damit umgehen musst. Ich freue mich, wenn Leute mich erkennen, aber ich empfinde mich als nicht so wichtig. PSW: Du bist für uns ein lustiger Mensch, so haben wir Dich alle erlebt. Ist das schwierig, wenn man beruflich lustig sein muss und dann auch noch privat? Lippert: Das hat wohl auch mit meiner Grundhaltung zum Leben zu tun. Ich kann allerdings auch sehr ernst oder sagen wir mal ernsthaft sein. Schwierigkeiten gibt’s wie in anderen Berufen natürlich auch. Einen Witz zu erzählen in einer fröhlichen Runde nach drei Gläsern Wein, das gelingt einem vielleicht besser, als wenn man diesen Witz 100 Mal hintereinander erzählen muss, mit derselben Freude, derselben Hingabe und demselben Esprit. Aber das erwarten die Menschen nun mal von mir. Menschen, Kommunikation, Nähe herstellen, Ängste und Vorurteile abbauen, mit Humor irgendwelche Nüsse knacken, so etwas hat mir schon immer Freude gemacht. Deswegen ist es schon fast so etwas wie ein Hobby. PSW: Letzte Frage: Was haben wir in nächster Zeit von Dir zu erwarten? Lippert: Ich habe glücklicherweise viel zu tun. Der MDR wird mit mir als Moderator den „Kessel Buntes” als Serie wieder aufleben lassen. Nicht mehr als große Bühnenshow, sondern als interessanten Rückblick auf großartige TV-Momente von ebenfalls großartigen Künstlern, mit denen ich auch noch aktuelle und bewegende Interviews führe. Ebenfalls für den MDR gibt es auch einige Formate der „Journalistischen Unterhaltung” wie z.B. „Wo unsere Promis Urlaub machten” usw. Das macht mir besonders viel Spaß, Gespräche mit Menschen zu führen und nach emotionalen Momenten zu „stöbern”. Und von 20. Juni bis 5. September 2015 stehe ich dann wieder als Sänger der „Störtebeker-Festspiele” fast täglich auf der Freilichtbühne in Ralswiek auf Rügen im aktuellen Stück „Aller Welt Feind”. Das Interview führte Dr. Peer Schmidt-Walther (PSW).
Kurzvita Wolfgang Lippert Als Sohn des Kapellmeisters Walter Lippert absolvierte der 1952 in Berlin/Kaulsdorf geborene Lippert ein zweijähriges Gesangs- und Klavierstudium an der Musikschule Berlin-Friedrichshain. 1982 wurde er mit einem Schlag landesweit bekannt: Sein Hit „Erna kommt” (im Westen von Hugo Egon Balder gecovert) stürmte die DDR-Hitparade. 1984 bekam „Lippi” seine erste eigene Samstagabendsendung im DDR-Fernsehen („Meine erste Show”). Bekannt wurde er als Showmaster, Moderator und Sänger ‒ in der DDR war er in den Achtzigern so populär wie Thomas Gottschalk im Westen. Kein Wunder, dass die Wahl auf „Lippi” fiel, als 1992 ein Nachfolger für Gottschalk bei „Wetten dass…?” gesucht wurde. Mit der Benefiz-Show „Künstler für Kinder”, seinem Gastspiel für den erkrankten Wim Thoelke bei „Der große Preis” (1991) und der Moderation der NDR-Talk-Show „III nach neun” qualifizierte er sich endgültig für die Erfolgs-Show des ZDF, die er 1994 aber wieder an Thomas Gottschalk abtrat. 2008 erscheint die von Jack White produzierte CD „Das überleben wir”. Im März 2011 stellte er auf der Leipziger Buchmesse seine Biografie „Lippis Bekenntnisse” vor. 2012 „schenkt” SONY Wolfgang Lippert die CD „Lippi kommt” ‒ sozusagen zum Geburtstag. Näheres auf der Homepage von Wolfgang Lippert: www.wolfganglippert.de |
||||||
 |
|||||||
|
|
|||||||
|
DER FALL COLLINI |
|||||||
|
|
|||||||
|
Lange beherrschten amerikanische Autoren diesen Teil der Krimi-Szene, im Buch und im Film: Die Auseinandersetzung um Schuld oder Unschuld eines Menschen. Wer wird vor Gericht gewinnen? Mit einem Strafverteidiger aus Berlin haben seit ein paar Jahren die amerikanischen Autoren Konkurrenz bekommen. Ferdinand von Schirach, geboren 1964, schreibt Bücher, die man nicht aus der Hand legen mag. „Der Fall Collini”, keine 190 Taschenbuchseiten lang, ist so eine Geschichte. Collini gibt sich als Mitarbeiter einer italienischen Zeitung aus, besucht im Berliner Hotel Adlon einen Mann von 85 Jahren, den er mit vier Schüssen in den Hinterkopf tötet. Dann nimmt er in der Lobby Platz und wartet auf seine Festnahme. Als seinen Verteidiger ruft der Ermittlungsrichter den jungen Anwalt Caspar Leinen an, der sich für den Notdienst der Strafverteidigervereinigung hat eintragen lassen, um erste Mandate zu bekommen. „Ich brauche keinen Anwalt”, sagt der Täter, „ich will mich nicht verteidigen, ich habe den Mann getötet.” Und dabei bleibt er. Was für ein Anfang einer Story. Ein geständiger Täter, ein ehrgeiziger Anwalt, ein erfahrener Richter: „Wohl aussichtslos für die Verteidigung… Aber irgendwann muss man ja anfangen.” Der Autor holt aus, erzählt die Geschichte des Anwalts, seine Jugend, seine erste Liebe, sein Studium. Zurück in die Gegenwart reißt ihn der Anruf eben jener Liebe: „Du verteidigst den Mörder meines Großvaters.” Und eben jenen Großvater kennt der junge Anwalt. Hans Meyer, der mit vier Kopfschüssen Getötete, ist Eigentümer und Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMF Meyer Maschinen Fabriken. Auf seinem Besitz hat der Anwalt als Junge manche Ferien verbracht. Eine gewagte Konstruktion, aber sie trägt die Geschichte, die man ohne Pause lesen wird. Ferdinand von Schirach hat nicht nur sein Fach studiert, sondern auch das Schreiben. Sicherlich nicht von ungefähr zitiert er auf dem Vorblatt des Buches Ernest Hemingway: „Wir sind wohl alle geschaffen für das, was wir tun.” An ihm hat der Autor seinen eigenen Stil geschult und schreibt schnörkellos, präzise in einer Mischung aus Mitgefühl und Distanz. Solch Stil ist selten geworden, man genießt ihn umso mehr. Irgendwann ahnt man, was den Täter zur Tat veranlasst haben könnte. Das bestätigt sich dann, ohne dass die Spannung nachlässt. Noch einmal packt uns die Story in der letzten Szene. Das hat man so nicht erwartet! Doch dann gibt es einen Anhang, zwei Paragraphen werden zitiert, in der alten und in |
der neuen Fassung. Und das ist der Augenblick, in dem man den „Fall Collini”
noch einmal ganz von vorne lesen möchte. Man sollte es tun.
|
||||||
 |
|||||||
|
►►► Tja, wir können nicht mit Menschen umgehen, die uns bedienen, weil wir das nicht mehr gelernt haben, merkte Hein plötzlich auf der letzten Kreuzfahrt. Wenn er manche Mitreisenden beobachtete, fiel ihm auf, wie unbeholfen sie sich verhielten, wenn der Steward ihnen die Karte gereicht hatte, die Speisekarte oder die Weinkarte. Das, das und das, hieß es da häufig, und der Zeigefinger ersetzte das Gespräch mit dem Steward. Und wenn das Getränk bestellt wurde, hörte man immer mal wieder nur „Bier” oder „Hauswein, rot”. Ein „bitte” fehlte häufig, und mit seinem Namen angeredet wurde der dienstbare Geist auch nur selten. Hein nennt sowas „Verrohung der Sitten” und fragt sich, was die Ursache ist. An Land gibt es Kellner, an Bord Stewards, beide beraten, nehmen Wünsche entgegen, bringen Speisen und Getränke und räumen wieder ab. Der an Land bringt die Rechnung und kassiert, der an Bord wird zwischendurch mal mit einem größeren oder am Ende mit einem großen Trinkgeld belohnt. Eigentlich müsste man also doch Übung haben im Umgang mit dienstbaren Geistern! Sind es die ungewohnte Umgebung, die unbekannten Mitreisenden am Tisch, das fremdländische Aussehen des Stewards oder die ungewohnte Bezeichnung für an sich bekannte Tellerinhalte? Hein meint, es liegt wohl an allem, aber vor allem daran, dass wir alle „bitte” und „danke” nicht mehr so häufig sagen, wie etwa unsere Großeltern und Eltern.
►►► Tja, auf Kreuzfahrten haben Hein und seine Herzallerliebste immer mal wieder nette Mitreisende getroffen und manchmal sogar Freundschaft mit ihnen geschlossen. Jetzt war Hein eine Woche allein auf einem Schiff und berichtete seiner Herzallerliebsten nach der Rückkehr, dass er immer allein gegessen habe und mit keinem Mitreisenden engeren Kontakt gefunden habe. Das konnte die Herzallerliebste sich gut vorstellen, sie hatte selber mal auf einer Busreise durch Kanada ähnliches erlebt. Die Paare blieben unter sich, Alleinreisende blieben allein. Natürlich war Hein auf dieser Reise nicht versauert, aber die ganze große Freude kam bei Tisch oder bei den Ausflügen nicht auf. Das lag sicher an der Kürze der Reise, meinte die Herzallerliebste. Man braucht ja wohl ein bisschen mehr Zeit, wenn man miteinander warm werden will. Stimmt, meinte Hein. Und freie Tischwahl ist dabei auch nicht hilfreich. Hein mag nicht so gern an einen Tisch treten, an dem schon zwei sitzen, wenn das halbe Restaurant noch leer ist und fragen, ob er sich dazu setzen kann. Also blieb er für sich und suchte nach Leidensgenossen. Die aßen aber offenbar zu ganz anderen Zeiten als er im Restaurant. Und als er dann bei einem Ausflug mit einem netten Ehepaar ins Gespräch kam und fragte, ob man sich zum Abendessen sehen wolle, hörte er nur Bedauern. Man hatte schon seinen festen Tisch. So blieb also nur die „watering hole”, wie die Engländer sagen, „die Wasserstelle” als der Ort, an dem man sich traf und Witterung aufnahm. Gottseidank war die Musik in dieser Bar leise genug, um zu reden. Und so gelang es Hein, zwei Kerle kennenzulernen, mit denen er Erfahrungen und Gedanken austauschen konnte. Mit dem einen tauschte er am Ende der Reise sogar Visitenkarten aus. Doch sicher ist Hein sich nicht, dass daraus mal eine nähere Bekanntschaft oder gar Freundschaft wird. Es geht eben nichts über die verbindende Kraft gemeinsamer Mahlzeiten.
►►► Tja, da gab’s doch hier an der Küste den Schnack „Wer nicht will deichen, muss weichen”, der auf Plattdeutsch noch schöner klang: „Wer nicht will dieken, de mut wieken”. Als der Schnack entstand, ging es um den Schutz des Küstenlandes vor Hochwasser durch den Bau von Deichen. Wer sein Land am Meeresrand hatte, musste beim Deichbau dabei sein. Wer nicht mitmachen wollte, steckte seinen Spaten ins Gras und verschwand – und gab seinen Landbesitz auf. Im Schutz des Deiches leben, ohne etwas dafür zu tun, gab es damals nicht. Heute ist das alles |
ganz anders geregelt, weiß Hein. Da zahlt man eine Abgabe und dann übernimmt irgendeine „Gemeinschaft” den Deichbau und den Küstenschutz. Ob das nun besser ist als damals, fragt Hein sich öfter mal. „Die da” beherrschen den Deichbau sicher besser als „wir”, also sollte man auf deren Können nicht verzichten. Aber wenn man solche Arbeiten delegieren kann, interessieren sie einen bald nicht mehr. „Die” machen es dann schon, sagt man sich und hängt dann oft noch den Gedanken ran, dass „die” ja dafür auch bezahlt werden. Solche Einstellung mag Hein nun ganz und gar nicht, aber ein Deichbauer wird aus ihm auch nicht werden, obwohl er nahe am salzigen Wasser lebt. Er zahlt seinen Obolus an den Deichverband, liest dessen Bericht über die Maßnahmen und lebt beruhigt hinter dem, was die anderen tun. Aber irgendwie, meint er, müsste er mehr tun. Aber was?
►►► Tja, das war früher mal besser – oder nur anders? Hein meint das Ablegen, das Verlassen eines Hafens auf einer Kreuzfahrt. Als Hein das erste Mal als Reisender an Bord ging, fand er auf dem Programm in der Kabine die Auslaufzeit. Sie lag deutlich vor dem Abendessen. Hein fand sich also gegen den Abendwind mit einem dicken Jackett geschützt an Deck ein, als sein Schiff Bremerhaven verließ, mit Schlepperhilfe ablegte, weil der Wind zu kräftig war. Da ertönte, als die letzte Leine gelöst war, eine Melodie über Deck, die Hein dann später immer wieder hörte: die Auslaufmelodie. Und so lief man auf die abendliche Nordsee, sah die Kajen kleiner werden, sah die ersten Feuer, entdecke draußen Ankerlieger und fuhr hinein in den Urlaub. Ein Drink an der Bar am Achterdeck und dann hinunter zum Essen. Diese Sitte scheint vergessen. Hein ist immer mal wieder auf Schiffen, die ohne Musik ablegen und anderen, die das während der Mahlzeiten tun. Hein nennt das „Aus dem Hafen schleichen” und findet das gar nicht schön. Auf den alten Ocean Linern gab es eine Bordkapelle, die beim Auslaufen aufspielte. Diese Zeiten sind lange vorbei. Aber über Lautsprecher kann man ja wohl eine herzergreifende, Sehnsucht weckende Musik auch einspielen. Nur bitte nicht beim Essen! Beim Auslaufen ist Heins Platz und der seiner Herzallerliebsten an der Reling, dort wo man den schönsten Ausblick hat. Doch leider klappt das nicht mehr bei jedem Auslaufen. Die Fahrpläne sind sicher enger geworden, die Vorgaben strikter, aber eine halbe Stunde lässt sich doch leicht einholen, wenn der nächste Hafen einen Tag entfernt liegt. Oder praktiziert man das nicht mehr, weil niemand sich mehr daran erinnert? Lasst uns das bei der nächsten Reise mal mit dem Kreuzfahrtdirektor besprechen, meint Hein. Irgendwann sind sie weg, Schiffe, mit denen man einst gereist war. Man liest eine Meldung, dass die Sowieso nun nicht mehr in Europa fährt oder aufgelegt ist oder verkauft wurde. Und was dann nur noch „East of Suez” fährt, ist in Europa schnell vergessen, zumal wenn das alte Schiff unter neuem Namen und mit einer anderen Flagge unterwegs ist. Hein bedauert das, kann daran aber nichts ändern. Umso wichtiger sind ihm seine Fotoalben und die zusammengehefteten Tagesprogramme seiner Schiffsreisen, die beide ziemlich viel Platz in seinen Regalen einnehmen. Da sind sie wieder präsent in aller Pracht, in Hochglanz und großformatig, und die Ferne und die Entdeckerfreude strömen einem aus den Seiten entgegen. ►►► Tja, Hein ist ja nun des Deutschen mächtig und des Englischen und kann sich auch noch in dieser und jener Sprache verständigen, die er als Segler in Häfen im Norden oder Süden Europas brauchte. Er ist dankbar dafür, denn jede Sprache eröffnet eine meistens andere Sicht auf das Leben. Neulich hat Hein zwei Damen zugehört, die sich fröhlich und in aller Freundschaft unterhielten – auf Deutsch. Dabei hörte er plötzlich ein Wort, das er nicht kannte, noch nie gehört hatte: beömmeln. Wir haben uns mächtig beömmelt, hieß der Satz. Im weiteren Zuhören tauchte ein weiteres Wort auf: hibbelig. Karl sei hibbelig, hieß es. Und dann war von etwas die Rede, das öddelig war. Vom einem Mann hieß es, er sei spiddelig. Hein wollte nicht nachfragen, was damit gemeint sei. Häufig versteht man fremde Worte, wenn man sie wieder und in anderen Zusammenhängen hört. Also abwarten. Doch dann hörte er, ein Freund habe etwas verkröst. Da hielt es Hein nicht mehr. Was denn das Wort „verkrösen” bedeute, wollte er wissen. Freundliches Nicken der Damen. „Verkrösen” hieße, etwas zu verlegen, ohne es je wieder zu finden. In welcher Sprache es denn das Wort gäbe? Im Missingsch, sagte die ältere Dame. Das spricht man in der Hamburger Gegend, ergänzte die jüngere. Hein kratzte sich hinter dem Ohr. Er sollte sich vielleicht doch mal längere Zeit in Hamburg bewegen, dachte er. Da wird es doch sicher noch viele andere ebenso schöne Worte geben, wie die eben gehörten. |
||||||
 |
|||||||
|
|||||||